1817 veröffentlichte Heinrich Zschokke „Das Goldmacherdorf“. Deutlich vor Hermann Schulze-Delitzsch und Friedrich Wilhelm Raiffeisen schilderte er darin wichtige Elemente des modernen Genossenschaftswesens. Das in viele Sprachen übersetzte Buch gilt als erster Genossenschaftsroman der Weltliteratur – ist heute aber weitgehend in Vergessenheit geraten.
Der Autor
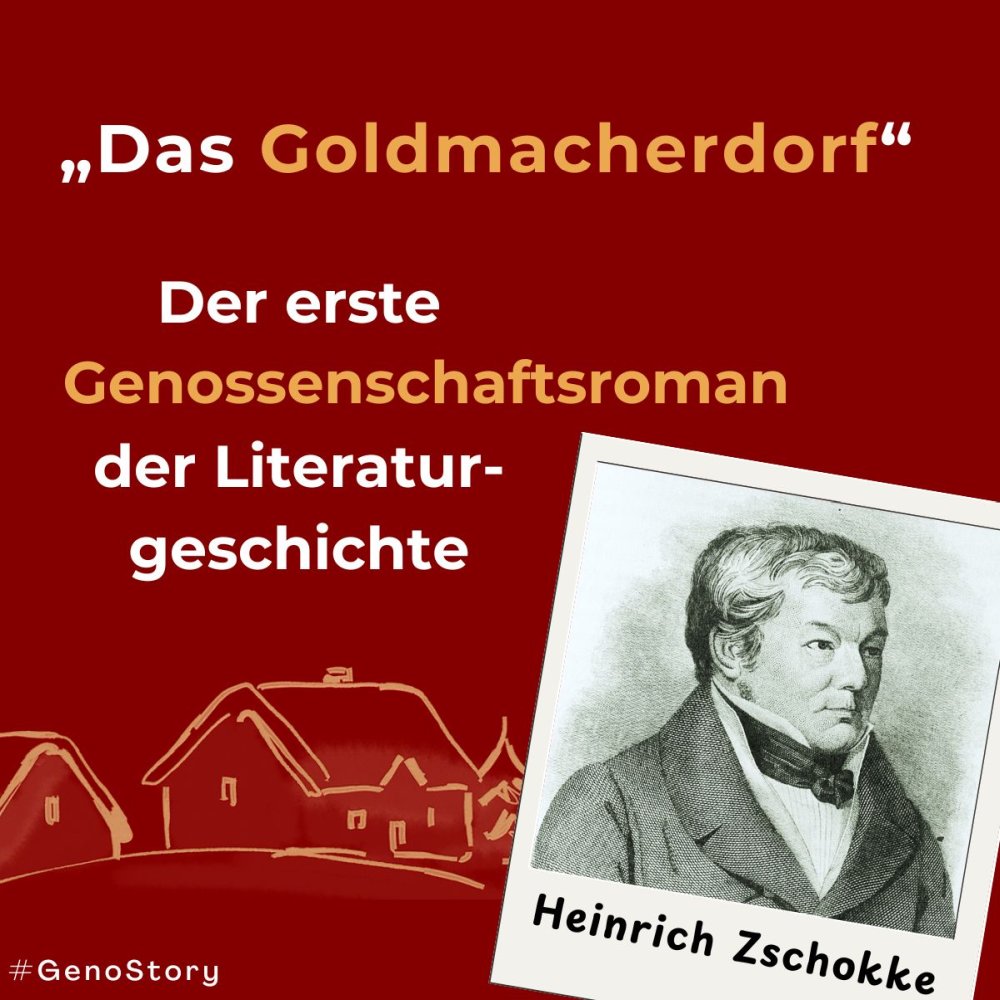 (Bild: Ge.Ko2/can)
(Bild: Ge.Ko2/can)Johann Heinrich Daniel Zschokke (1771-1848) war ein vielseitiger deutscher Schriftsteller, Historiker und Pädagoge. Nach dem Studium der Philosophie und Theologie an der Universität Frankfurt (Oder) und der Promotion 1792 wanderte der gebürtige Magdeburger 1796 in die Schweiz aus. Hier übernahm er die Leitung einer philanthropisch orientierten Schule, engagierte sich für die Verbesserung des Schulwesens und wurde zunehmend politisch aktiv. Daneben betätigte er sich als Historiker – vor allem in Bezug auf die Geschichte der Schweiz und Bayerns – und als Schriftsteller. Zschokke verfasste eine Vielzahl von Romanen, Erzählungen und historischen Abhandlungen und wurde damit zu einem der meistgelesenen deutschsprachigen Schriftsteller seiner Zeit. 1817 veröffentlichte er – zuerst als Fortsetzungsroman in einer Zeitung – sein Werk „Das Goldmacherdorf“. Es spiegelt seine humanitären und pädagogischen Ideale wider und betont den Wert von Gemeinschaft und Zusammenarbeit.
Das Buch
„Das Goldmacherdorf“ erzählt die Geschichte vom Schulmeistersohn Oswald, der nach vielen Jahren im Krieg zurück in sein Heimatdorf Goldenthal kommt. Dort übernimmt er das kleine Haus und die Felder seines inzwischen verstorbenen Vaters. Oswald ist sehr erschrocken über den sichtbaren Niedergang und die Verwahrlosung des Dorfes. „Das Elend schaute zu den Fenstern hinaus, und am Feuerherd kochte Schmalhans ungeschmalzte Suppen“, summiert Zschokke die erbärmlichen Zustände, für die er auch Gründe nennt: Die Bauern seien gleichgültig geworden. Sie würden ihr Geld zu oft in die Kneipen tragen und sich für Trunk und Spiel bei den wenigen Reichen im Dorf „um doppelten und dreifachen Zins“ verschulden. Könnten sie ihre Schulden nicht zahlen, werde ihnen nach und nach alles Hab und Gut gepfändet und am Schluss bliebe ihnen nur noch der Bettelstab.
Oswald versucht die Dorfbewohner aufzurütteln, weniger zu spielen und zu zechen, mehr auf sich und ihre Sachen zu achten und gemeinsam ihr Geschick in die Hand zu nehmen – doch bei den meisten schlägt ihm blanke Ablehnung entgegen. Um zumindest der Jugend etwas von seinen Ansichten mitzugeben, übernimmt er unentgeltlich die vakante Stelle des Schulmeisters. Zudem verliebt er sich in die Tochter des Müllers und hält um ihre Hand an. Der Müller wollte eigentlich einen möglichst wohlhabenden Schwiegersohn, gibt dann aber doch Oswald und seiner Tochter seinen Segen. Die Dorfbewohner sind davon sehr überrascht. Schnell machen Gerüchte die Runde: Der arme Schulmeister habe seine Seele dem Teufel verschrieben, im Gegenzug sei er in schwarze Künste eingeweiht worden und könne Gold machen. Wie sonst hätte er, der arme Schulmeister, den Müller von der Hochzeit mit seiner Tochter überzeugen können?
Bald wenden sich immer mehr Hausväter heimlich an Oswald, er möge sie doch ebenfalls die Kunst des Goldmachens lehren, sie würden dafür auch dem Teufel ihre Seele zuschreiben. Oswald sieht darin eine Chance und versammelt die Männer schließlich eines Nachts in seinem Haus. Dort wirft er ihnen vor, von Gott abgefallen zu sein, Teufelei getrieben zu haben und so arm und verzweifelt geworden zu sein. Dann schüttet er einen Sack voll Gold vor ihnen aus und erklärt sich bereit, sie nicht die teuflische, sondern die ehrliche Art das Goldmachen zu lehren. Dafür müssten die 32 anwesenden Hausväter aber während einer siebenjährigen Probezeit sieben Gebote befolgen. Insbesondere sollten sie sich, ihr Heim und ihre Felder sauber und in Ordnung halten, in die Kirche statt ins Wirtshaus gehen, zu Gott beten, sich vom Glücksspiel fernhalten, nicht fluchen und ihr Tagewerk mit Fleiß und Treue verrichten. Die Anwesenden stimmen dem zu, ihr Handschlag mit Oswald besiegelt ihren geheimen Bund.
Langsam beginnt danach der Wandel im Dorf, den Oswald (später zusammen mit dem Pfarrer) engagiert und mit immer neuen Ideen vorantreibt. Dabei greift Zschokke wiederholt Ideen und Konzepte auf, wie sie sich einige Jahrzehnte später bei der Entwicklung der modernen Genossenschaften wiederfinden. So lässt er Oswald eine „Ersparniskasse“ einrichten, die die Spargroschen der Dorfbewohner für Zins und Zinseszins in der Stadt anlegt. Ebenso werden auf Oswalds Vorschläge hin eine Gemeinschaftsküche und eine Gemeinschaftskäserei eingerichtet, ein Gemeindewaschhaus errichtet und Gemeinschaftsback- und Dörrofen gebaut.
Sieben Jahre später bittet Oswald jeden der an der ursprünglichen Übereinkunft beteiligten Familienväter einzeln, ihm kurzfristig eine größere Geldsumme zu leihen und zur Abendzeit in sein Haus zu bringen. So versammelt sich der Goldmacherbund zur festgesetzten Stunde erneut. Oswald beglückwünscht die Mitglieder zum Bestehen der Probezeit und dazu, dass sie – und mit ihnen als Vorbild auch viele andere Dorfbewohner – erfolgreich die Kunst des ehrlichen Goldmachens gelernt haben. Ihr in großer Summe mitgebrachtes Geld sei der beste Beweis dafür.
Damit endet im Prinzip die Geschichte mit den vielen genossenschaftlichen Anleihen. Zwischen den Zeilen wirbt Zschokke wiederholt für die Selbsthilfe und lässt sogar schon den bekannten Genossenschaftsspruch erklingen: „Einer für alle, alle für einen!“ Wen wundert es da am Ende noch, dass Oswald nach all dem Guten, dass er für das Dorf und seine Bewohner getan und angestoßen hatte, von diesen seither nur noch „Vater Oswald“ genannt wurde.
„Das Goldmacherdorf“ ist Teil des „Projekt Gutenberg“ und kann hier nachgelesen werden: Heinrich Zschokke, „Das Goldmacherdorf“.
Weiterführende Artikel auf genostory.de:
(Ende) genostory.de/25.02.2025/mar
